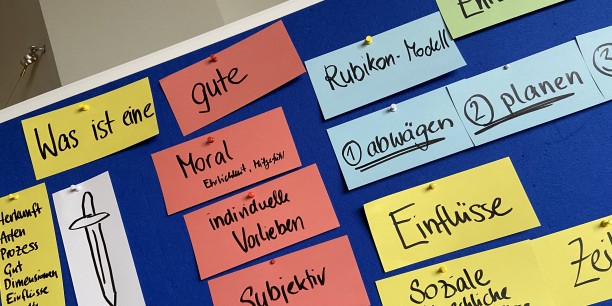Nicht normal? Rechte Parteien im Osten

Podium moderiert von Heinz-Joachim Lohmann (Ev. Akademie zu Berlin) mit den Verfassungsschutz-Chefs Jörg Müller (Brandenburg) und Stephan J. Kramer (Thüringen) (v.l.n.r.). Foto: © Schreiter/ EAT 
Podium moderiert von Christoph Maier (Ev. Akademie Sachsen-Anhalt) mit Annalena Schmidt (AG Kirche für Demokratie und Menschenrechte, Radebeul), Dorothea Marx (MdL Thüringen, SPD) und Katrin Rudolph (Superintendentin, Zossen) (v.l.n.r.). Foto: © Sc 
Sebastian Kranich (Ev. Akademie Thüringen) im Gespräch mit Constance Arndt (Oberbürgermeisterin, Zwickau). Foto: © Schreiter/ EAT
Noch durchgefroren von der Eröffnung der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg wurde Reiner Haseloff (CDU) am Freitagabend zugeschaltet zum Kongress „Demokratie ist ein Marathon. Über den Umgang mit rechten Parteien im Osten Deutschlands“. Seine Botschaft an die 80 Teilnehmenden in den Franckeschen Stiftungen zu Halle war deutlich: Keine Kompromisse. Gegen die rechten Parteien haben wir nur dann eine Chance, wenn wir uneingeschränkt klar sind. Das gilt auch für den Kommunal- und Selbstverwaltungsbereich.
Gezielt hatten die vier Evangelischen Akademien im Osten einen konservativen Ministerpräsidenten eingeladen, um den Diskursraum zum Thema zu weiten. Doch wie ist er überhaupt, der Osten? – für Valerie Schönian erlebte „Avantgarde“ – im Guten wie im Schlechten. Wir hätten somit gar keine andere Wahl als hoffnungsvoll zu sein, so die Journalistin zu Beginn. Der Kulturwissenschaftler Alexander Leistner beschrieb ihn in seinem Vortrag als kulturell-mental different und eigensinnig im Vergleich zum Westen. Die AFD mache sich das zunutze, indem sie etwa an die Erfahrung des Systembruchs 1989/90 anknüpfe mit Parolen wie „Vollende die Wende“. Eindringlich warnte er vor Destabilisierung der Demokratie von innen wie außen und schlug eine „Absage an Geist, Logik und Praxis der Destabilisierung“ vor.
Tagtäglich damit zu tun haben die Verfassungsschutz-Chefs Stefan Kramer (Thüringen) und Jörg Müller (Brandenburg). Beide beobachten eine wachsende Radikalisierung von Teilen der Bevölkerung. Beide betonten im Podiumsgespräch zugleich die Mehrheit derer, die demokratische Parteien wählen. 10%-15% der Bevölkerung sei wirklich rechtsextrem, so Kramer. Den Rest könne man zurückholen. Doch auf welche Weise? Kramer meinte: „Der beste Verfassungsschutz sind mündige Bürgerinnen und Bürger.“ Müller setzte kritisch hinzu: Die AFD nimmt und die positiven Begriffe weg und wir lassen sie uns wegnehmen. Anschließend betonte er: „Die Demokratie wird die AfD überleben. […] Vertrauen Sie auf die Werkzeuge der Demokratie. Aber das Vorfeld gehört komplett verboten.“
Die Thüringer Landtagsabgeordnete Dorothea Marx (SPD) plädierte nach der Haseloff-Schalte auch für ein Verbot der AFD. Sie wolle der AFD damit die staatliche Parteienfinanzierung, die „Kriegskasse wegnehmen“. Sonst komme tagtäglich auf Haltung an. „Das ist doch das Leben, das wir verteidigen wollen: Würde, Vielfalt und Humor. Wir müssen doch nicht so verbissen sein wie die“, so Marx. Und: Widerspruch heißt Sprechen, so einhellig mit ihr auch die beiden weiteren Frauen auf dem Podium Annalena Schmidt (AG Kirche für Demokratie und Menschenrechte) und Katrin Rudolph (Superintendentin Zossen).
Hier die Inhalte und Workshops des Kongresses am Samstag zu präsentieren, würde zu weit führen. Zu viel wäre es auch, auf all die Begegnungen, Gespräche, Vernetzungen in den Pausen und bei den Mahlzeiten einzugehen, die mehr als Beiwerk waren.
Das Abschlusspodium am Samstagnachmittag wendete das Thema noch einmal ins Kommunale. Deutlich wurde dabei, wie unterschiedlich eine Oberbürgermeisterin (Constance Arndt, Zwickau), ein Rechtsextremismus-Experte (David Begrich, Magdeburg) und der Sprecher eines zivilgesellschaftlichen Bündnisses (Niklas Gerlach, Halle gegen Rechts) manches sehen und interpretieren, auch wenn sie sich im Grunde einig sind. Das liegt, soweit klar, auch an den Funktionen und Aufgaben, die jede und jeder hat:
Wie umgehen mit der extremen Rechten? Oberbürgermeisterin Arndt setzt auch auf das persönliche Gespräch mit Mitgliedern aller Fraktionen im Zwickauer Stadtrat. Niklas Gerlach lehnt für das Bündnis in Halle jegliche Kooperation ab. Und David Begrich empfiehlt: „Man muss den Kakao, durch den man als demokratische Partei gezogen wird, nicht auch noch austrinken.“ Hierbei seien Tabubrüche und Provokationen auseinanderzuhalten. Bloße Provokationen sollte man ignorieren, echte Tabubrüche dafür aber konsequent sanktionieren. Kritisch merkte er zugleich an: „Auf Normalisierung folgt Machtzuwachs. Und dafür haben wir noch keinen Umgang. Die Normalisierung ist durch, die halten wir nicht mehr auf.“
Im Sommer soll eine epd-Dokumentation des Kongresses erscheinen.